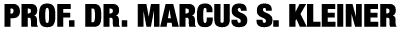Pop ist die Akademie des Alltags – Marcus S. Kleiner im Interview mit Oliver Uschmann
trailer: Herr Kleiner, der unter jungen Menschen weiterhin grassierende Berufswunsch, „irgendwas mit Medien zu machen“, führt üblicherweise in die Arbeitslosigkeit oder ins Dauerpraktikum. Sie hingegen haben ihn als Professor und gefragter Experte in Presse, Radio und Fernsehen auf maximal gloriose Art umgesetzt. Wie schafft man das denn?
Marcus S. Kleiner: Leidenschaft, Konsequenz und glückliche Zufälle. In dieser Reihenfolge, gleich mehrfach hintereinander. Nach Abitur und Zivildienst wollte ich in meiner gnadenlosen, narzisstischen Selbsteinschätzung als 18-Jähriger eigentlich Schauspieler werden. Zugleich hatte meine Philosophie-Lehrerin auf dem Gymnasium in Xanten am Niederrhein bereits meine Liebe zum Denken geweckt. Zum Denken und zum ästhetischen Genießen.
Und zum konzeptuellen und theoretischen Reflektieren, oder?
Absolut. Im Deutschunterricht faszinierte mich, wie literarische Figuren stellvertretend für uns die Dinge durchleben. In der Politik, wie alles zusammenhängt und sich die Welt aus verschiedenen Perspektiven denken lässt. Was ist überhaupt Gesellschaft? Was Kommunikation? Solche Fragen haben mich schwer geprägt. Die Popwelt hatte für mich auch immer mit Denken zu tun. Allein, wie in Songtexten und Performances philosophische Höhen und Tiefen zelebriert werden können …
Jetzt fragt sich der kleine Mann an der Trinkhalle natürlich: Wofür bezahle ich mit meinen Steuern als Malocher einen Medienprofessor? Einen Ingenieur, einen Mathematiker, vielleicht auch einen Anglisten, der Englischlehrer ausbildet, das kann ich einsehen. Wie erklären Sie bei einem Bier und einem Frühstückskorn den Nutzen Ihrer Fachdisziplin?
Zu Anfang meiner Laufbahn als Akademiker habe ich noch geglaubt, Bildungsarbeit sei selbstevident. Ist doch klar, dass es die Geisteswissenschaften geben muss. Wir müssen uns nicht legitimieren. Das sehe ich heute anders. Man sollte in der Tat erklären, wieso diese gut bezahlte Existenz auch für Menschen relevant ist, die an harten Maschinen schuften oder das Grubenholz hauen, um im Klischee zu bleiben. Denn selbstverständlich sind nicht nur die Aussterbenden Malocher, sondern auch Ärzte oder Lehrerinnen. Dieses Festhalten am Proletarierklischee, das es in der Wirklichkeit kaum noch gibt, nutzen manche als Vorwand, sich niemals entwickeln zu müssen.
In Ordnung, der Mensch soll sich öffnen und seine geistige Bockigkeit nicht zur Klassen-Ehre hochjazzen. Dennoch: Was hat beispielsweise die Vorliebe für eine bestimmte Musik oder das Nachdenken oder Nichtnachdenken über Filme, Serien oder Alltagskultur für einen Einfluss auf den Weltengang?
Es geht um die Fähigkeit, die Reibungen und Widersprüche einer Zeit zu identifizieren, um über Skepsis, Zweifel und kritisches Denken weiterzukommen. Denn wie Bert Brecht so schön gesagt hat: Wenn es Widersprüche gibt, gibt es Hoffnung. Die Welt ist weder am Ende noch leben wir in der besten aller möglichen Zeiten. Man darf sich halt niemals einrichten. Das ist mir am wichtigsten, wenn ich Unterricht gebe oder mich öffentlich zum Zeitgeschehen äußere. Ich möchte die Leute aus der Komfortzone dessen herausholen, was man alltäglich denkt und von dem man glaubt, dass es das absolut Richtige ist, weil man sich daran gewöhnt hat.
Foucault hatte seine Machtanalyse, Luhmann seine Systemtheorie, Postman seine Medien-Ökologie: Was ist Ihr spezielles, eigenständiges Denkmodell?
Früher war ich fasziniert von solchen Welterklärungsmustern, doch nach der Promotion habe ich den Glauben an und das Verlangen nach Großtheorien komplett verloren. Ein großer, eigener Theorieentwurf wäre für mich wie ein Gefängnis, das mich festlegt, obwohl ich permanent weitergehe, weil ich dauernd Neues kennenlerne. Mein Fokus liegt auf Pop und Kritik von Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft, Politik. Das ist wohl mein genuinster Beitrag, den so vorher noch niemand ganz klar formuliert hat: Pop als Bildungskultur.
Trägt das Nachdenken über Pop den Bildungsaspekt in sich oder die Popkultur selbst?
Die Popkultur selbst. Pop enthält die ganze Welt im Kleinen, ist ein Tummelfeld für große Gefühle, tiefe Diskurse oder völligen Nonsens. Pop ist die Akademie des Alltags, ein Bildungsprogramm außerhalb der offiziellen Stellen und Institutionen. Über ihn abstrakt nachzudenken, ist professionalisierte Bildungsarbeit, Wissensarbeit, letztlich Hermeneutik. In ihn abzutauchen, Subkulturen mitzumachen und im ästhetischen Erlebnis aufzugehen, war für mein Leben aber die noch prägendere Erfahrung.
Wie zeigt sich denn die Universitätswelt von innen? Immerhin gibt es dort nur sehr wenige Positionen für tausende qualifizierter Anwärter.
Der akademische Betrieb ist ein hart umkämpftes Feld. Niemand kann einfach so von Magister über Promotion bis Habilitation durchmarschieren. Missgunst, Neid, Ausgrenzung und Negativität sind durchaus Alltag in den Fluren. Ich musste lernen, dass die klassische Universität nicht einladend, sondern eher ausschließend ist. Das Hochschul- und Wissenschaftssystem bildet eine vollkommen eigene Sphäre, der ich seit der Promotionszeit sehr ambivalent gegenüberstehe. Es hat mich als System nie angezogen, doch ich liebe es, mich in Themen zu graben, zu unterrichten und fürs Nachdenken und Texte schreiben bezahlt zu werden.
Sie lehren in der Medienhauptstadt Berlin, leben aber als Ruhrgebietsgewächs in Duisburg. Was bedeutet Ihnen die Stadt?
Der ganze Ruhrpott ist für mich wie ein Naherholungsgebiet. Alles wirkt so entspannt und locker. Meine Frau und ich leben am Kaiserberg, mit Blick auf den Wald in der Nähe des Zoos. Besser geht’s nicht. Der Landschaftspark, der Revierpark Mattlerbusch, die Sechs-Seen-Platte, aber auch die alten traditionellen Clubs wie das Djäzz oder das Café Steinbruch – sobald ich in Duisburg eintreffe, kann ich loslassen und ganz bei mir sein, auch wenn die Einfahrt selbst durch den sehr schäbigen Bahnhof getrübt wird. In Duisburg bleiben alle Fünfe gerade.
Im Vergleich zu Berlin ist es popkulturell allerdings tiefste Provinz, oder?
Das Ruhrgebiet verkauft sich unter Wert. Wir haben die Ruhrtriennale oder das Traumzeit-Festival, aber die Künstler dort sind größtenteils eingekauft und kaum aus der Region. Die lokalen Akteure sind häufig wütend und enttäuscht über die mangelnde Wertschätzung, richten sich aber auch ein wenig in der Klagerolle ein. Es fehlt die Energie zu sagen: Komm, geiler Scheiß, wir machen jetzt was vom Pott aus!
Interview: Oliver Uschmann